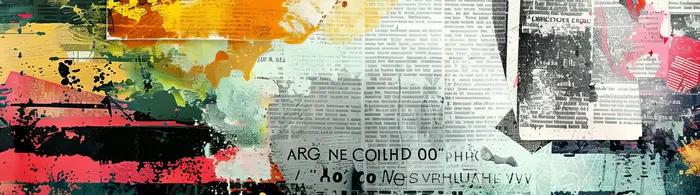Informationsbrief Steuern & Recht - Februar 2024
Informationsbrief Steuern & Recht
Für Unternehmen
Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 2. November 2023 (Az. 3 K 2755/22 Erb) entschieden, dass die auf den Erwerb eines gegen eine GmbH gerichteten Ausschüttungsanspruchs entfallende Kapitalertragsteuer nicht als Nachlassverbindlichkeit abzuziehen ist. Den Anteil an einer GmbH in Höhe von 12,5 % des Stammkapitals erwarb der Kläger mittels des Vermächtnisses von seinem verstorbenen Vater. Die Gesellschafterversammlung hatte vor dem Tod des Vaters eine Ausschüttung beschlossen. 187.000 EUR entfielen als Anteil unter Einbehalt von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (ca. 48.000 EUR) an den Kläger. Der Kläger forderte das Finanzamt auf, die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag als Nachlassverbindlichkeit in Abzug zu bringen.
Den Erbschaftsteuerbescheid hatte das Finanzamt mit einer Forderung im Nennwert von 187.500 EUR angesetzt. Das Finanzgericht Münster hat die hiergegen gerichtete Klage abgewiesen. Der Ausschüttungsanspruch gegenüber der GmbH sei mit dem Nennwert anzusetzen. Eine Bewertung unterhalb des Nennwerts im Hinblick auf die Kapitalertragsteuer komme nicht in Betracht, da es sich hierbei um eine besondere Form der Erhebung der Einkommensteuer handele und nicht um eine wertmindernde Eigenschaft. Auch ein Abzug der Kapitalertragsteuer als Nachlassverbindlichkeit komme nicht in Betracht. Zwar wurde die wirtschaftliche Ursache für die Belastung der Ausschüttung mit Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag bereits vor dem Todeszeitpunkt gesetzt. Denn sobald die Ausschüttung durch die Gesellschafterversammlung beschlossen war, stand fest, dass für die nicht beherrschenden Gesellschafter im Zeitpunkt der Fälligkeit des Zahlungsanspruchs zugleich Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag einzubehalten und abzuführen war, § 43 Abs. 1 EStG.
Der für die Abzugsfähigkeit bei der Erbschaftsteuer maßgebliche Umstand, die Verwirklichung des einkommensteuerlich relevanten Tatbestandes, war indes vor dem Tod des Vermächtnisgebers durch die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung noch nicht verwirklicht. Denn es fehlte insoweit noch am den Tatbestand begründenden Zufluss der Ausschüttung. Gewinnanteile und andere Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, deren Ausschüttung von einer Körperschaft beschlossen wird, fließen dem Gläubiger der Kapitalerträge, wenn er – wie die Kläger und zuvor sein Vater – nicht beherrschender Gesellschafter der Gesellschaft ist, erst an dem Tag der Auszahlung zu. Schließlich gebietet der Umstand, dass die Ausschüttung beim Kläger einen Kapitalertragsteuertatbestand verwirklicht und damit eine besondere Form der Erhebung der Einkommensteuer auslöst, nicht, dass deshalb die Erbschaftsteuerbelastung des Klägers sinken müsste.
Quelle: Finanzgericht Münster, Newsletter Dezember 2023
Grundsätzlich müssen alle Unternehmer, die Waren oder Dienstleistungen gegen Entgelt an Endverbraucher verkaufen, einer Bonpflicht nachkommen. Es steht dem Unternehmer frei, den Bon in Papierform oder – bei Zustimmung des Kunden – in digitaler Form im PDF-Format anzubieten.
Wichtig ist, dass alle Pflichtangaben enthalten sind. Bis 2023 musste der Bon bereits enthalten:
- Name und Anschrift des Unternehmens
- Datum der Ausstellung des Kassenbons
- Menge und Art des gelieferten Gegenstands oder Art und Umfang der erbrachten sonstigen Leistung
- Entgelt und Steuerbetrag sowie Umsatzsteuersatz bzw. Verweis auf eine Steuerbefreiung
- Betrag je Zahlungsart
- Zeitpunkt und Ende der Abrechnung des "Vorgangs"
- Transaktionsnummer
- Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems oder des Sicherheitsmoduls
- Signaturzähler
- Prüfwert
Zum 1. Januar 2024 zusätzlich verpflichtend:
- Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems
- Seriennummer des Sicherheitsmoduls
- Prüfwert (§ 2 S. 2 Nr. 7 KassenSichV)
- Von der TSE vergebener fortlaufender Signaturzähler
Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (WIdNr.) wird ab Herbst 2024 vergeben werden. Damit wird jede wirtschaftlich tätige natürliche Person, jede juristische Person und jede Personenvereinigung jeweils ein einheitliches und dauerhaftes Merkmal zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung in Besteuerungsverfahren erhalten.
Die Vergabe der WIdNr. erfolgt aus technischen und organisatorischen Gründen in Stufen. Sie setzt sich aus dem Kürzel „DE“ und neun Ziffern zusammen. Ergänzt wird die WIdNr. durch ein 5-stelliges Unterscheidungsmerkmal für einzelne Tätigkeiten, Betriebe oder Betriebsstätten (Beispiel für eine WIdNr.: DE12345678900001).
Die Wirtschafts-Identifikationsnummer dient zugleich auch als bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer nach dem Unternehmensbasisdatenregistergesetz. Das Unternehmensbasisdatenregister ist ein zentrales und ressortübergreifendes Vorhaben zur Verwaltungsdigitalisierung und -modernisierung. Ziel des Basisregisters ist es, Unternehmen von Berichtspflichten zu entlasten, indem Mehrfachmeldungen der Stammdaten an unterschiedliche Register vermieden werden („Once-Only“Prinzip).
Quelle: BMF
Einkommensteuer und persönliche Vorsorge
Grundfreibetrag, Unterhaltshöchstbetrag:
Für das Jahr 2024 erhöht sich der Grundfreibetrag auf 11.604 EUR. Durch diese Erhöhung wird Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine geringere Lohnsteuer bezüglich ihrer monatlichen Gehaltszahlungen berechnet. Außerdem wird der Höchstbetrag der abzugsfähigen Unterhaltsleistungen auf die Höhe des Grundfreibetrags angehoben.
Höhere Einkommensgrenzen bei Arbeitnehmer-Sparzulage:
Die Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage werden verdoppelt. Sie betragen damit 40.000 EUR für Ledige und 80.000 EUR bei einer Zusammenveranlagung. Dies gilt für die Anlage der vermögenswirksamen Leistungen in Vermögensbeteiligungen (u. a. Investmentfonds) und für die wohnungswirtschaftliche Verwendung der vermögenswirksamen Leistungen (u. a. Bausparen).
Abschluss der Familienkassenreform:
Kindergeldangelegenheiten werden ab dem 1. Januar 2024 allein durch die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit bearbeitet. Die Reform sorgt für eine Beseitigung der Sonderzuständigkeiten von über 8.000 Familienkassen des öffentlichen Dienstes.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass der entgeltliche Erwerb eines Anteils an einer Erbengemeinschaft nicht zur anteiligen Anschaffung eines zum Gesamthandsvermögen der Erbengemeinschaft gehörenden Grundstücks führt.
In vorliegenden Fall streiten die Beteiligten über das Vorliegen von Einkünften nach § 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 EStG in der im Streitjahr 2018 gültigen Fassung (EStG) wegen der Veräußerung von zur Erbmasse gehörendem Grundbesitz nach dem Erwerb aller übrigen Miterbenanteile durch einen Erben.
Der Kläger ist Erbe mit einem Erbanteil von 52 % nach der 2015 verstorbenen Erblasserin. Zu seinen Lasten wurde Nacherbfolge angeordnet. Weitere Erben zu jeweils 24 % und zugleich Nacherben nach dem Kläger wurden die Kinder der Erblasserin. Der Kläger und die Kinder der Erblasserin wurden im Grundbuch eines Grundstücks als Eigentümer in Erbengemeinschaft eingetragen (2015).
Mit notarieller Urkunde (2017) übertrugen die Kinder der Erblasserin als Nacherben das Nacherbenanwartschaftsrecht an dem Erbteil des Klägers mit allen Rechten und Pflichten an diesen zur Alleinberechtigung und traten dieses Recht mit sofortiger dinglicher Wirkung ab. In der Folge übertrugen die Kinder der Erblasserin ihren Erbanteil an einen Dritten. Nach der Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts übertrug dieser die von den beiden Kindern der Erblasserin erworbenen Erbanteile auf den Kläger. Zugleich wurde die Erbengemeinschaft auseinandergesetzt.
Der Kläger wendete den in der notariellen Urkunde genannten Betrag für die Erbanteile der Kinder der Erblasserin auf. Der Kläger veräußerte den aus dem Nachlass stammenden Grundbesitz (2018). Mit geändertem Einkommensteuerbescheid für 2018 berücksichtigte das Finanzamt daher zusätzlich Einkünfte aus einem privaten Veräußerungsgeschäft, da zwischen dem Erwerb des Grundstückes und dem Verkauf nicht mehr al 10 Jahre gelegen haben.
Die Entscheidung des BFH: Nach dem Wortlaut sowie dem Sinn und Zweck des § 23 EStG sollen innerhalb der Veräußerungsfrist realisierte Wertänderungen eines bestimmten Wirtschaftsguts im Privatvermögen des Steuerpflichtigen der Einkommensteuer unterworfen werden. Daraus ergibt sich das Erfordernis der Nämlichkeit von angeschafftem und innerhalb der Haltefristen veräußertem Wirtschaftsgut, wobei Nämlichkeit Identität im wirtschaftlichen Sinn bedeutet.
Im Grundsatz führt der entgeltliche Erwerb eines Anteils an einer gesamthänderischen Beteiligung nicht zur (anteiligen) Anschaffung der Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens. Eine gesamthänderische Beteiligung ist kein Grundstück und auch kein Recht, das den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegt. Auch wenn sich im Gesamthandsvermögen nur Grundstücke befinden.
Somit sind die Voraussetzungen eines privaten Veräußerungsgeschäfts i.S.v. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht gegeben. Es besteht keine Nämlichkeit zwischen dem angeschafften und dem veräußerten Wirtschaftsgut. 2017 erwarb der Kläger die Erbanteile der beiden Kinder der Erblasserin, mithin die quotenmäßig bestimmte Teilhaberschaft an der Erbengemeinschaft als Gesamthandsgemeinschaft. 2018 veräußerte er hingegen das aus dem Nachlass stammende Grundstück.
Quelle: BFHUrt. v. 26.9.2023 – IX R 13/22
Die Finanzverwaltung hat die Umzugskostenpauschalen nach dem Bundesumzugskostengesetz ab dem 1. März 2024 veröffentlicht. Danach können z. B. sonstige Umzugsauslagen ohne Nachweise für den Umziehenden mit 964 EUR statt bisher 886 EUR angesetzt werden. Für jede andere Person steigt die Pauschale von bisher 590 EUR auf 643 EUR.
Bauen und Vermieten
Vermieter können bis zum 31. März 2024 einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der zuständigen Gemeinde für das Jahr 2023 stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vorjahr zu verzeichnen hatten, vorausgesetzt, der Steuerpflichtige ist nicht selbst für die Ertragsminderung verantwortlich (z. B. Zahlungsunfähig keit des Mieters, Hochwasserschaden,..).
Zugrunde gelegt wird die geschätzte übliche Jahresrohmiete und die Höhe des Ausfalls.
- Ausfall von mehr als 50 %: Grundsteuererlass von 25 %
- vollständiger Ausfall der Mieteinnahme: Grundsteuererlass von 50 %
Sollte der Ausfall des Mietertags dauerhaft bestehen, kann die Minderung ggf. im Rahmen einer Fortschreibung in Betracht gezogen werden.
Das Finanzgericht Köln hatte zu entscheiden, ob die Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung für die Ablösung eines Darlehens im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung für 2018 als Werbungkosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen ist. Der Kläger machte hinsichtlich der Einkünfte aus Vermietung unter anderem Schuldzinsen als Werbungkosten geltend.
Das bei Anschaffung im Jahr 2006 darlehensfinanzierte Objekt wurde Mitte 2018 veräußert. Er erklärte, dass sich der Betrag aus Schuldzinsen und einer Vorfälligkeitsentschädigung zusammensetze. Für die vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens belastete die finanzierende Bank dem Kläger eine Vorfälligkeitsentschädigung. Der Veräußerungserlös des Objekts sei zur Tilgung des Darlehens verwendet worden. Zudem seien mit dem überschießenden Restbetrag die Darlehen der übrigen Vermietungsobjekte (teilweise) zurückgeführt worden, so dass sich die Zinslast insoweit in den Folgejahren reduziere. Vor diesem Hintergrund sei die Vorfälligkeitsentschädigung als „vorweggenommener Werbungskostenabzug“ berücksichtigungsfähig.
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Der Einkommensteuerbescheid sowie die hierzu ergangene Einspruchsentscheidung sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass die vom Kläger gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung nicht in dem für den Abzug als Werbungkosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung erforderlichen wirtschaftlichen Zusammenhang steht.
Bei der Leistung einer Vorfälligkeitsentschädigung im Zuge der Veräußerung von Immobilien wird der unter Umständen zunächst bestehende und durch die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Anschaffungskosten einer der Vermietung dienenden Immobilie begründete wirtschaftliche Zusammenhang mit einer bisherigen Vermietungstätigkeit überlagert bzw. ersetzt von einem neuen, durch die Veräußerung ausgelösten Veranlassungszusammenhang. Ist dieser Veräußerungsvorgang – z. B. nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG – steuerbar, ist die Vorfälligkeitsentschädigung als Veräußerungskosten in die Ermittlung des Veräußerungsgewinnes oder -verlustes einzustellen. Ist der Veräußerungsvorgang wie im Urteilsfall nicht steuerbar, kann die Vorfälligkeitsentschädigung nicht "ersatzweise" als Werbungskosten im Zusammenhang mit der bisherigen steuerbaren Tätigkeit – wie vorliegend der Vermietung und Verpachtung – geltend gemacht werden.
Quelle: Finanzgericht Köln, 11 K 1802/22
Für Heilberufe
Die Ärztekammer Hessen appelliert an die Arztpraxen, beim elektronischen Rezept (E-Rezept) die Komfortsignatur der Praxisverwaltungssysteme (PVS) zu nutzen. Erst durch die elektronische Signatur wird das Rezept erstellt. Wird seitens des Arztes eine Stapelsignatur verwendet und diese nur ein oder zweimal täglich erstellt, hat der Patient unmittelbar nach dem Arztbesuch unter Umständen kein abrufbares Rezept zur Vorlage in der Apotheke.
Die Komfortsignatur der PVS mache dagegen eine umgehende Signatur des Rezeptes möglich. Die Ärztekammer ruft den Gesetzgeber auf, die Hersteller von PVS-Systemen dazu zu verpflichten, die Voraussetzungen für einen reibungslosen Einsatz des E-Rezepts zu schaffen. Der Aufwand in den Praxen ist durch das E-Rezept stark gestiegen. Unverständnis äußert die Ärztekammer auch darüber, dass die Krankenkassen gesetzlich Krankenversicherten nicht über das seit Beginn des Jahres verpflichtende E-Rezept informiert hätten.
Quelle: aerzteblatt.de
Sparer
Der Anleger eines Investmentfonds hat als Investmentertrag unter anderem die Vorabpauschale nach § 18 InvStG zu versteuern (§ 16 Absatz 1 Nummer 2 InvStG). Die Vorabpauschale 2024 gilt gemäß § 18 Absatz 3 InvStG beim Anleger als am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres – also am 2. Januar 2025 – zugeflossen. Die Vorabpauschale 2024 ist unter Anwendung des Basiszinses vom 2. Januar 2024 zu ermitteln. Die Höhe des Basiszinssatzes leitet sich anhand von Zinsstrukturdaten aus der langfristig erzielbaren Rendite aus Bundesanleihen ab. Der variable Zinssatz wird zum 1. Börsentag eines Jahres ermittelt. Für die Ermittlung der Vorabpauschale für das Jahr 2024 wird der Basiszinssatz vom 2. Januar 2024 zugrunde gelegt und wurde vom Bundesfinanzministerium auf 2,29% festgesetzt. Damit liegt der Basiszinssatz für die Vorabpauschale 2024 geringfügig unter Basiszinssatz für die Vorabpauschale 2023 (2,55%).
Lesezeichen
Der Kaufkraftausgleich soll den Kaufkraftverlust ausgleichen, der dem Empfänger der Bezüge aufgrund der Lebenshaltungskosten am ausländischen Dienstort entsteht. Mit dem aktuellen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium (BMF) nun die Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1. Januar 2024 veröffentlicht: tinyurl.com/yc3ze5ja
WICHTIGER HINWEIS
Die Inhalte unseres Schreibens wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Gesetze und Rechtsprechung ändern sich fortlaufend. Nutzen Sie deshalb unser Schreiben zur Information. Bitte denken Sie aber daran, dass Sie vor Ihren Entscheidungen grundsätzlich steuerliche oder rechtliche Beratung in Anspruch nehmen, weil wir sonst keine Verantwortung übernehmen können.